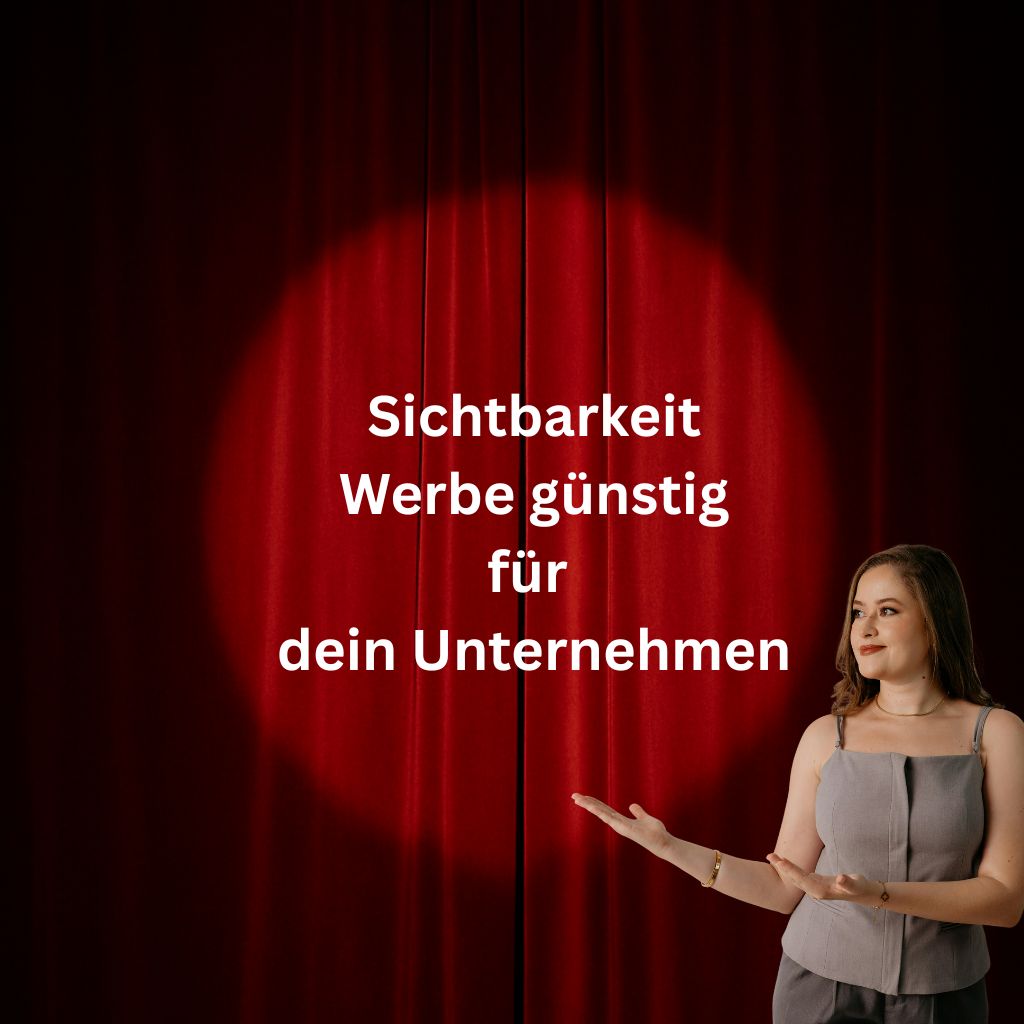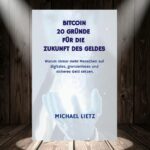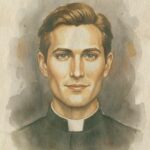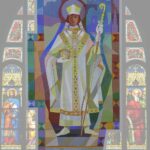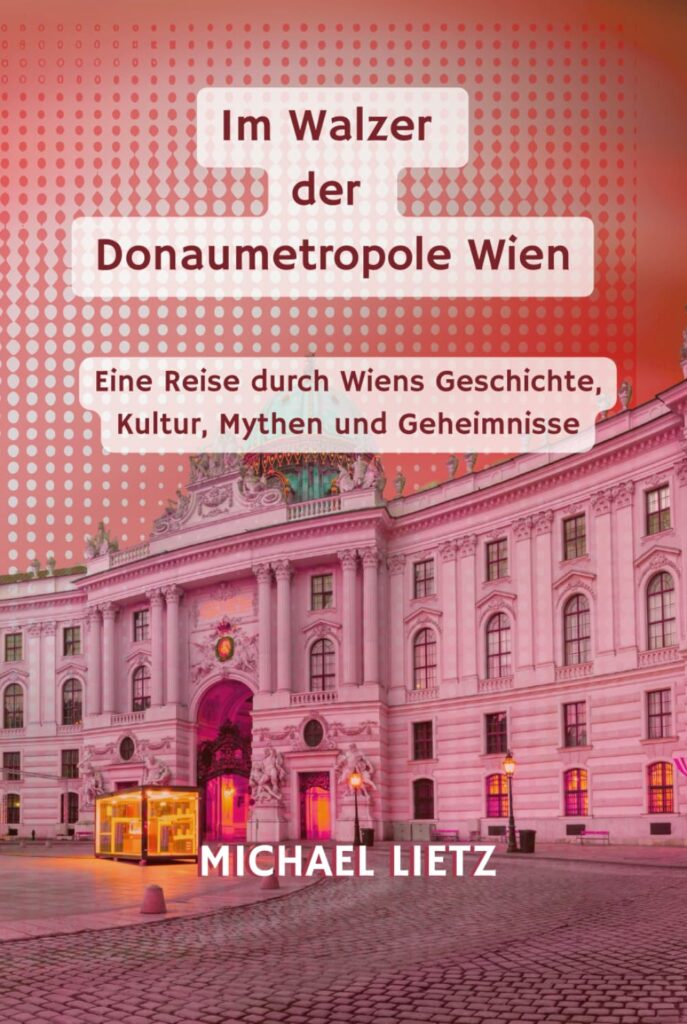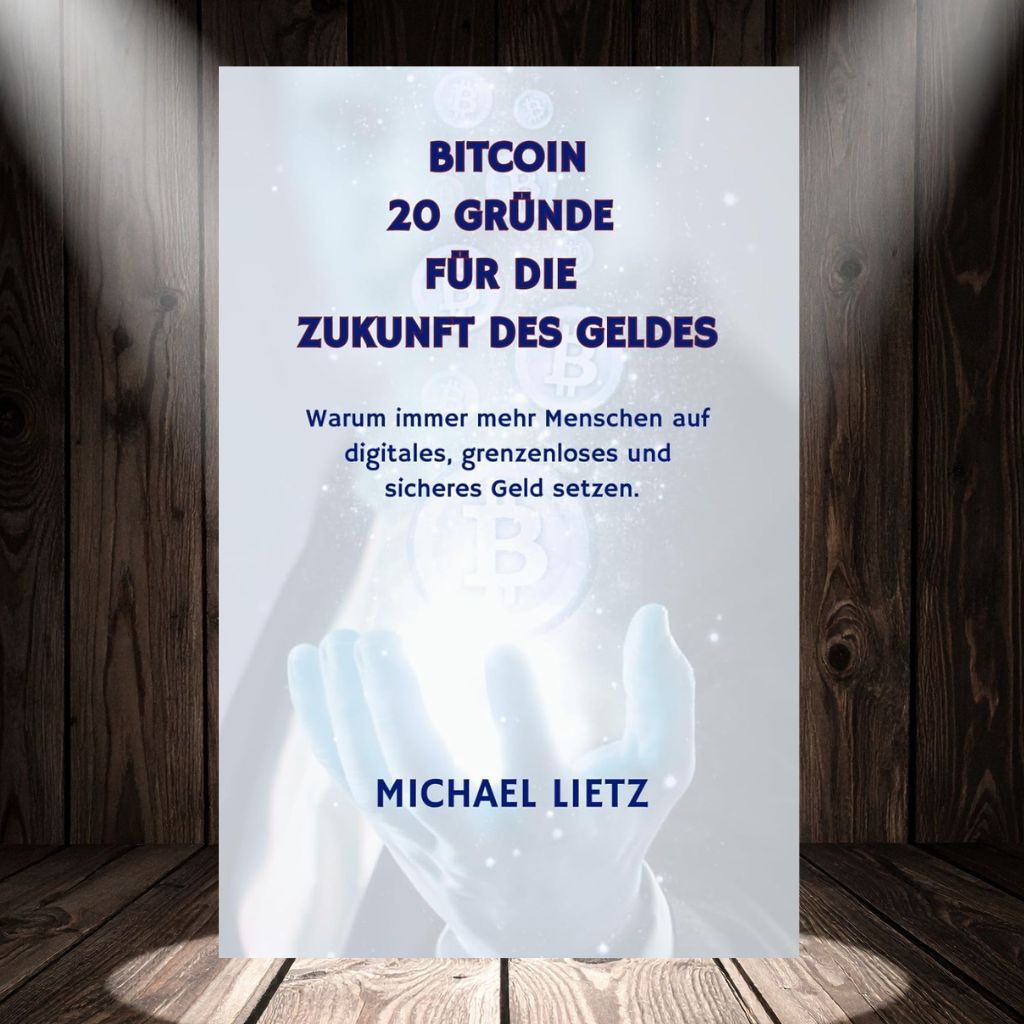Es war der 5. Dezember 1791, ein eisiger Tag in Wien, als Wolfgang Amadeus Mozart starb – jung, nur 35 Jahre alt, mitten in der Arbeit an seinem geheimnisvollen Requiem. Kaum hatte sich die Nachricht in der Stadt verbreitet, begannen die Gerüchte zu brodeln. Ein Genie tot, plötzlich, unerwartet – das konnte doch kein Zufall sein! Bald wurde ein Name in den Kaffeehäusern und Salons der Stadt geflüstert: Antonio Salieri. Der Hofkomponist, der ältere, mächtigere Rivale Mozarts, sollte den jungen Meister vergiftet haben, so hieß es.
In den Gassen Wiens sprach man von Eifersucht, von Intrigen, von einem tödlichen Giftbecher. Und wie es so ist, wenn eine Geschichte zu gut ist, um nicht erzählt zu werden, wuchs sie von Woche zu Woche. Bald hieß es, Mozart habe selbst kurz vor seinem Tod davon gesprochen, er sei vergiftet worden. Manche behaupteten, er habe gesagt, jemand habe ihn beauftragt, sein eigenes Requiem zu schreiben, weil er bald sterben würde. Und tatsächlich: Mozart war in seinen letzten Wochen zunehmend von düsteren Ahnungen geplagt. Er war überzeugt, er schreibe das Requiem nicht für einen fremden Auftraggeber, sondern für sich selbst.
Im Walzer der Donaumetropole Wien: Eine Reise durch Wiens Geschichte, Kultur, Mythen und Geheimnisse
Hol dir das Lesevergnügen – Klick auf das Buchcover
Stellen wir uns die Szene vor: Wien im Advent, Schneeflocken wirbeln durch die Gassen, die Kerzen in den Fenstern flackern. Mozart liegt in seiner Wohnung am Rauhensteingraben, von Fieber geschüttelt, während im Nebenzimmer seine Schüler und seine Frau Constanze das Requiem proben, damit er es noch hören kann. Er, der lebensfrohe, sprühende Mozart, ist plötzlich ein Mann, der den Tod nahen fühlt. Kein Wunder, dass seine Worte die Phantasie der Zeitgenossen befeuerten.
Antonio Salieri, der angebliche Täter, war zur selben Zeit ein angesehener Komponist am kaiserlichen Hof. Er war älter, hatte die besten Posten, war gut vernetzt – alles, was Mozart oft verwehrt blieb. Die Vorstellung, Salieri habe den genialen Jüngeren vergiftet, passte perfekt in das Bild eines eifersüchtigen Rivalen. Und die Gerüchte hielten sich hartnäckig, obwohl es nie Beweise gab.
Jahre später, als Salieri alt und krank war, soll er selbst gestanden haben, Mozart vergiftet zu haben – zumindest wurde es so erzählt. Andere Quellen sagen, er habe das Gegenteil beteuert. Diese widersprüchlichen Berichte machten die Geschichte nur noch spannender. Aus der nüchternen Realität eines frühen Todes wurde ein Kriminalfall, der bis heute die Fantasie beflügelt.
Tatsächlich ist es höchst unwahrscheinlich, dass Mozart ermordet wurde. Mediziner und Historiker haben viele Theorien untersucht: von einer Streptokokkeninfektion über eine Nierenerkrankung bis hin zu einer Autoimmunreaktion. Doch die Mordtheorie lässt sich nicht aus den Köpfen der Menschen vertreiben. Sie ist zu dramatisch, zu verführerisch.
Klick auf das Bild / Buchcover
Die Legende fand ihren Höhepunkt im 20. Jahrhundert, als der Dramatiker Peter Shaffer sie in seinem Stück Amadeus wieder aufgriff. Später wurde daraus der berühmte Film, der Millionen Zuschauer in aller Welt fesselte. Hier wurde Salieri zum teuflischen Gegenspieler, zum intriganten Hofkomponisten, der Mozart systematisch in den Wahnsinn trieb. Natürlich war dies Theater, eine meisterhaft erzählte Geschichte – doch sie prägte das Bild von Salieri bis heute.
Vielleicht ist es genau das, was diese Geschichte so besonders macht: Sie zeigt uns Mozart nicht nur als strahlenden Komponisten, sondern als verletzlichen Menschen. Er war ein Genie, das um Anerkennung kämpfte, das sich unverstanden fühlte und schließlich, am Ende seines kurzen Lebens, das Gefühl hatte, Opfer einer großen Verschwörung zu sein.
Und vielleicht brauchte die Welt auch diesen Mythos. Der Gedanke, dass ein Genie einfach so, an einer Krankheit, sterben könnte, war zu banal, zu traurig. Eine Mordgeschichte, ein geheimer Rivale, ein Giftbecher – das machte den Tod zu einer Tragödie von Shakespeare’schem Ausmaß.
Wer heute Salzburg besucht, spürt noch den Hauch dieser Geschichte. In der Getreidegasse, wo Mozarts Geburtshaus steht, drängen sich die Besucher. Man sieht die Tasteninstrumente, die Notenblätter, man spürt das Feuer seines Genies. Und wenn man sich ein wenig Zeit nimmt, kann man sich vorstellen, wie dieser junge Mann nach Wien ging, voller Ideen, voller Musik, voller Träume – und wie er viel zu früh starb.
Die Mordgeschichte hat Salzburg und Wien gleichermaßen geprägt. Sie hat dazu beigetragen, dass Mozart nicht nur als Komponist, sondern als Figur der Popkultur unsterblich wurde. Er ist nicht nur der Schöpfer der Zauberflöte, der Don Giovanni und der Jupiter-Symphonie – er ist auch der Held eines der größten musikalischen Krimis der Geschichte.
Vielleicht ist das das Geheimnis seines anhaltenden Ruhms: Mozart ist mehr als Musik. Er ist ein Mythos. Und wie bei jedem Mythos mischen sich Wahrheit und Dichtung, Klatsch und Historie, bis man sie nicht mehr trennen kann.
Wenn also das nächste Mal jemand im Café Tomaselli in Salzburg sitzt, einen Verlängerten trinkt und über Mozart spricht, dann wird man auch wieder fragen: War da etwas dran? Wurde er wirklich vergiftet? Und schon lebt sie weiter, die spannendste Legende der Musikgeschichte.