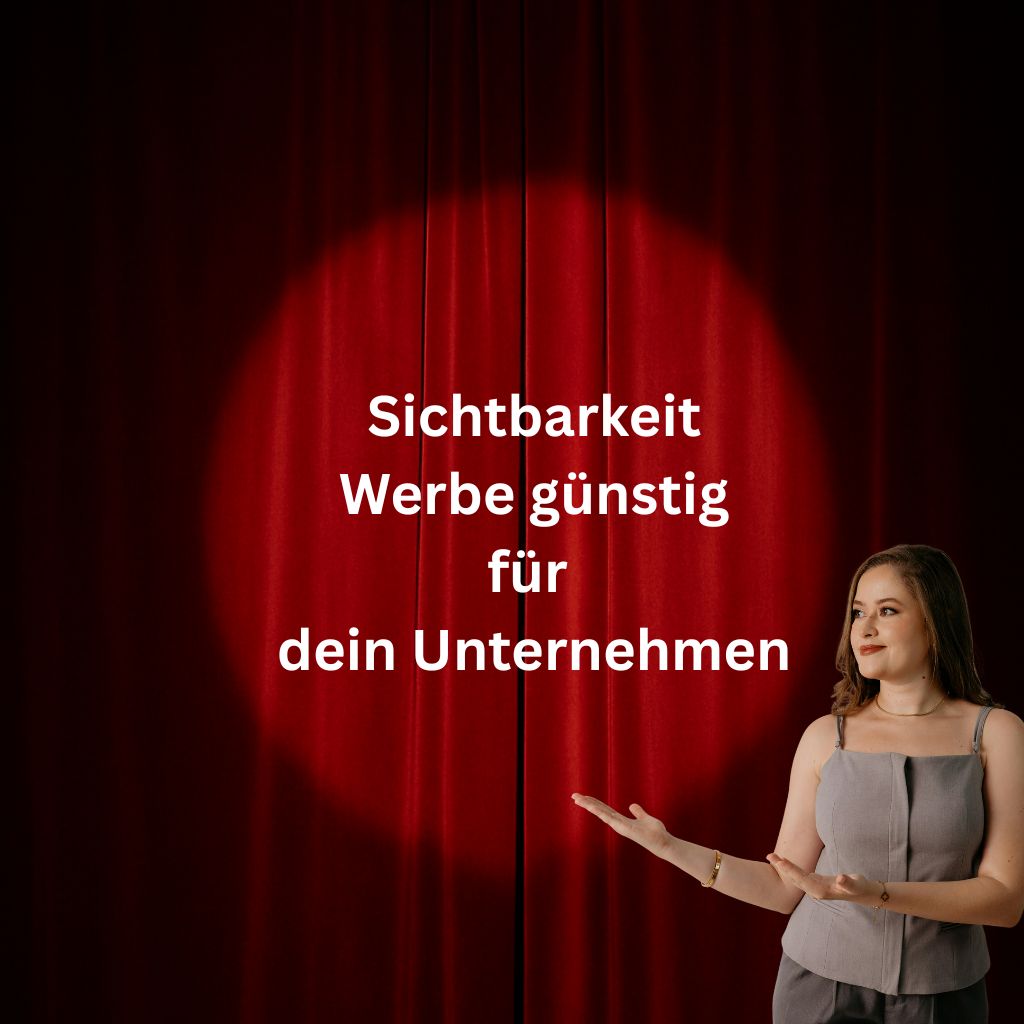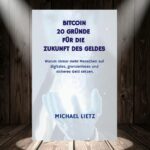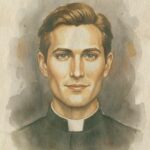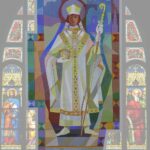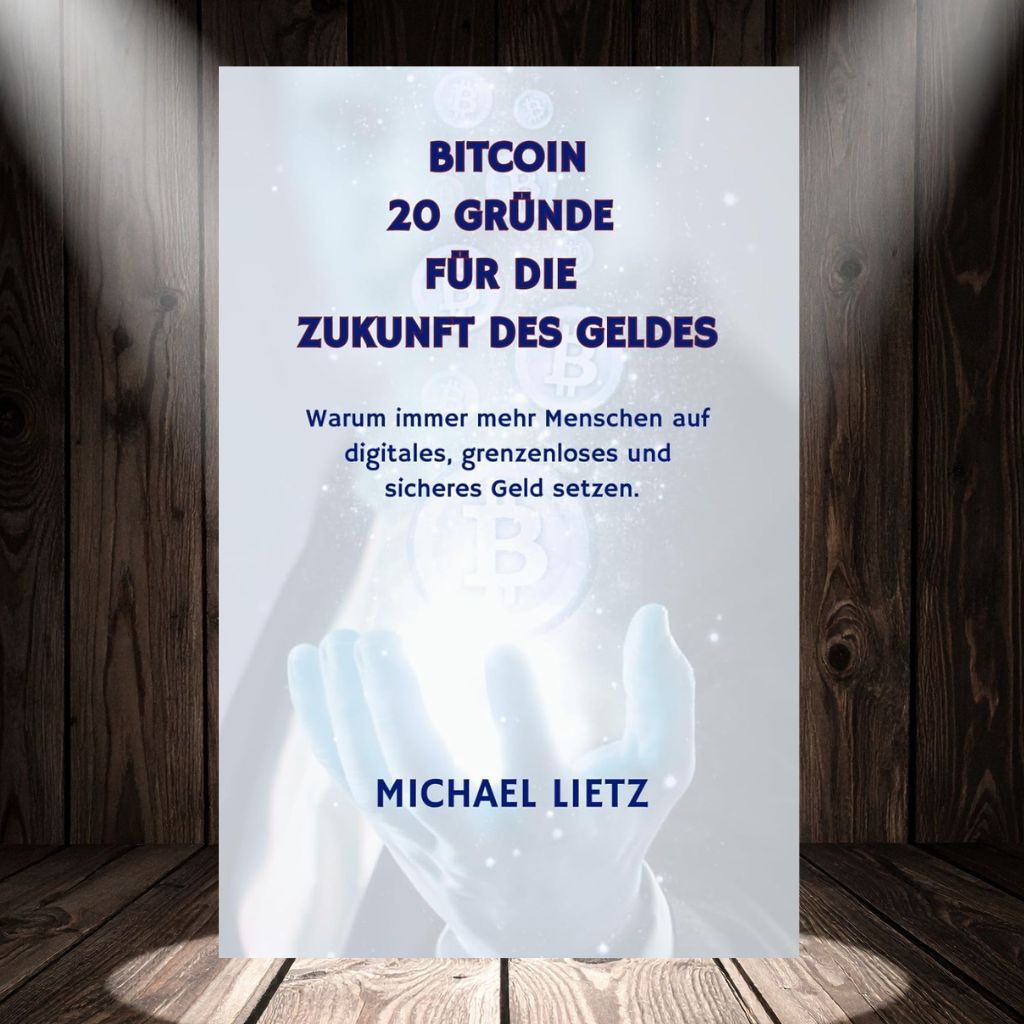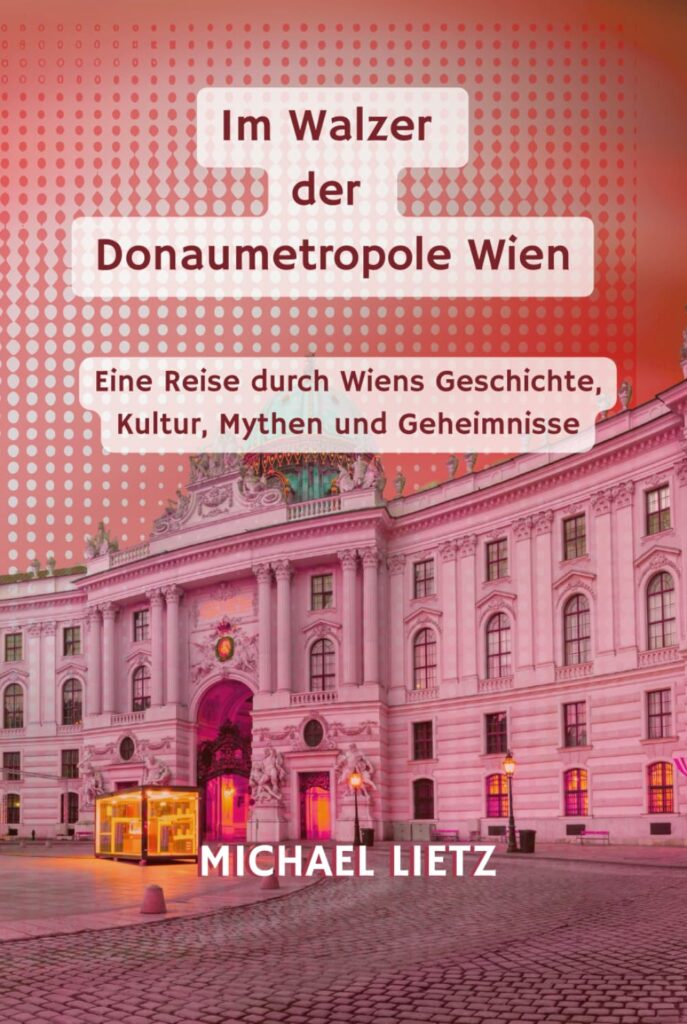Salzburg, 1681. Es war eine Zeit, in der Angst durch die Gassen wehte wie ein eisiger Wind. Die Menschen hatten kaum Zeit, sich vom letzten Krieg zu erholen, die Ernte war schlecht, Krankheiten grassierten, Kinder starben. Und wie so oft in Zeiten der Not suchte man nach Schuldigen. Bald flüsterte man in den Tavernen und auf den Märkten ein Wort, das allen den Atem gefrieren ließ: Hexerei.
Im Mittelpunkt des Salzburger Gerüchte-Sturms stand eine Frau, die heute fast vergessen ist, damals aber der Stadt den Atem raubte: Maria P., eine einfache Magd aus Gnigl. Sie war jung, klug, nicht auf den Mund gefallen – Eigenschaften, die in jener Zeit gefährlich sein konnten. Man sagte, sie könne Kranke heilen, dass sie mit Kräutern mehr anstellte, als die Kirche erlaubte. Manche behaupteten, sie habe das Vieh der Nachbarn verhext, andere schworen, sie habe in der Walpurgisnacht auf dem Gaisberg mit dem Teufel getanzt.
Bald war aus dem Flüstern ein Geschrei geworden. „Habt ihr schon gehört?“, fragte man sich auf dem Residenzplatz. „Die Magd aus Gnigl hat den Sohn vom Müller krank gemacht – und er ist gestorben!“ Ob es stimmte, spielte kaum eine Rolle. Die Angst machte aus Gerüchten Wahrheiten. Und so wurde Maria festgenommen und in den düsteren Zwinger der Stadt gebracht.
Klick auf das Bild / Buchcover
Die Prozesse waren öffentliches Spektakel. Die Leute strömten herbei, um die Angeklagte zu sehen. Manche hatten Mitleid, andere wollten Blut sehen. Man raunte, dass sie beim Verhör Dinge gestand, die kein Mensch wissen konnte. Natürlich wissen wir heute, dass Geständnisse oft unter Folter erzwungen wurden – doch damals war das für die Zuschauer nur ein weiterer Beweis für ihre Schuld.
Die Gerüchte wurden immer wilder. „Sie hat mit dem Teufel einen Pakt geschlossen“, rief eine Frau auf dem Markt. „Ich habe gesehen, wie sie nachts am Fluss war und mit den Geistern sprach“, sagte ein anderer. Und schon war das Urteil klar, noch bevor das Gericht tagte.
Am Tag der Hinrichtung war die Stadt wie elektrisiert. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer: Heute wird die Hexe verbrannt! Kinder kletterten auf Zäune, die Erwachsenen drängten sich auf dem Platz, die Glocken läuteten dumpf. Es war ein makabrer Festtag, ein Spektakel, das die Menschen zugleich erschreckte und anzog.
Maria P. wurde auf den Richtplatz geführt. Man sagt, sie habe gefasst gewirkt, ihre Augen hätten nicht gezittert. Manche behaupteten, sie habe die Menge angesehen, als wollte sie sagen: „Ihr irrt euch.“ Dann loderte das Feuer. Rauch stieg auf, der Geruch von Pech lag in der Luft, und die Menschen sahen zu, als würde mit der Angeklagten auch die eigene Angst verbrennen.
Doch es war nicht der letzte Fall. Die Salzburger Hexenprozesse zogen sich über Jahre hin, und Dutzende, ja Hunderte Menschen fielen ihnen zum Opfer. Besonders Frauen, die aus der Norm fielen – zu selbstbewusst, zu klug, zu arm oder zu reich – gerieten ins Visier. Es war eine Zeit, in der Klatsch tödlich sein konnte.
Im Walzer der Donaumetropole Wien: Eine Reise durch Wiens Geschichte, Kultur, Mythen und Geheimnisse
Hol dir das Lesevergnügen – Klick auf das Buchcover
Salzburg war in dieser Epoche eine Stadt voller Spannungen. Auf der einen Seite der barocke Glanz der Fürsterzbischöfe, auf der anderen das einfache Volk, das in ständiger Angst vor Hunger, Krankheit und Strafe lebte. Die Hexenprozesse waren ein Ventil für diese Ängste. Wer jemandem nicht traute, konnte flüstern: „Hexe!“ – und schon war das Leben des anderen in Gefahr.
Rückblickend sehen wir die Tragödie klarer. Doch damals war die Hinrichtung einer vermeintlichen Hexe ein Akt, der die Ordnung wiederherstellen sollte. Und die Menschen erzählten noch wochenlang davon. „Hast du gesehen, wie sie gelacht hat, als das Feuer brannte?“, soll jemand gesagt haben. „Das war der Teufel, der aus ihr sprach!“ Der Klatsch der Stadt machte aus jeder Hinrichtung eine Geschichte, die weitergetragen wurde, bis die Angst neue Opfer forderte.
Heute kann man sich kaum vorstellen, wie es war, wenn in Salzburg die Scheiterhaufen loderten. Wer durch die Altstadt geht, sieht vielleicht die barocken Fassaden, hört den Klang von Musik, spürt den Zauber der Festspiele. Doch hinter dieser Kulisse liegt auch diese dunkle Vergangenheit. Die Plätze, auf denen wir heute flanieren, waren einst Orte der Angst.
Und vielleicht ist es genau das, was die Geschichte so faszinierend macht: Sie erinnert uns daran, dass Klatsch, Tratsch und Gerüchte eine unheimliche Macht haben. Sie können Karrieren zerstören, Freundschaften brechen – und damals konnten sie Leben kosten.
Wer heute Salzburg besucht, kann die Stätten dieser Vergangenheit entdecken: die Festung, die Gefängnisse, die Orte, an denen Gericht gehalten wurde. Und wenn man dort steht, kann man sich vorstellen, wie es war, als die Stadt den Atem anhielt, wenn wieder eine Hexe verhaftet wurde. Man hört fast das Gemurmel der Menge, das Knistern des Holzes, das letzte Aufbäumen der Beschuldigten.
Die Geschichte von Maria P. und den anderen „Salzburger Hexen“ ist kein Märchen, sondern eine Mahnung. Sie zeigt, wie gefährlich Angst und Gerüchte sein können – und wie schnell eine Stadt in den Wahn verfallen kann. Doch sie macht Salzburg auch zu einem Ort, der nicht nur barocken Glanz, sondern auch tiefe, dunkle Geschichten zu erzählen hat.